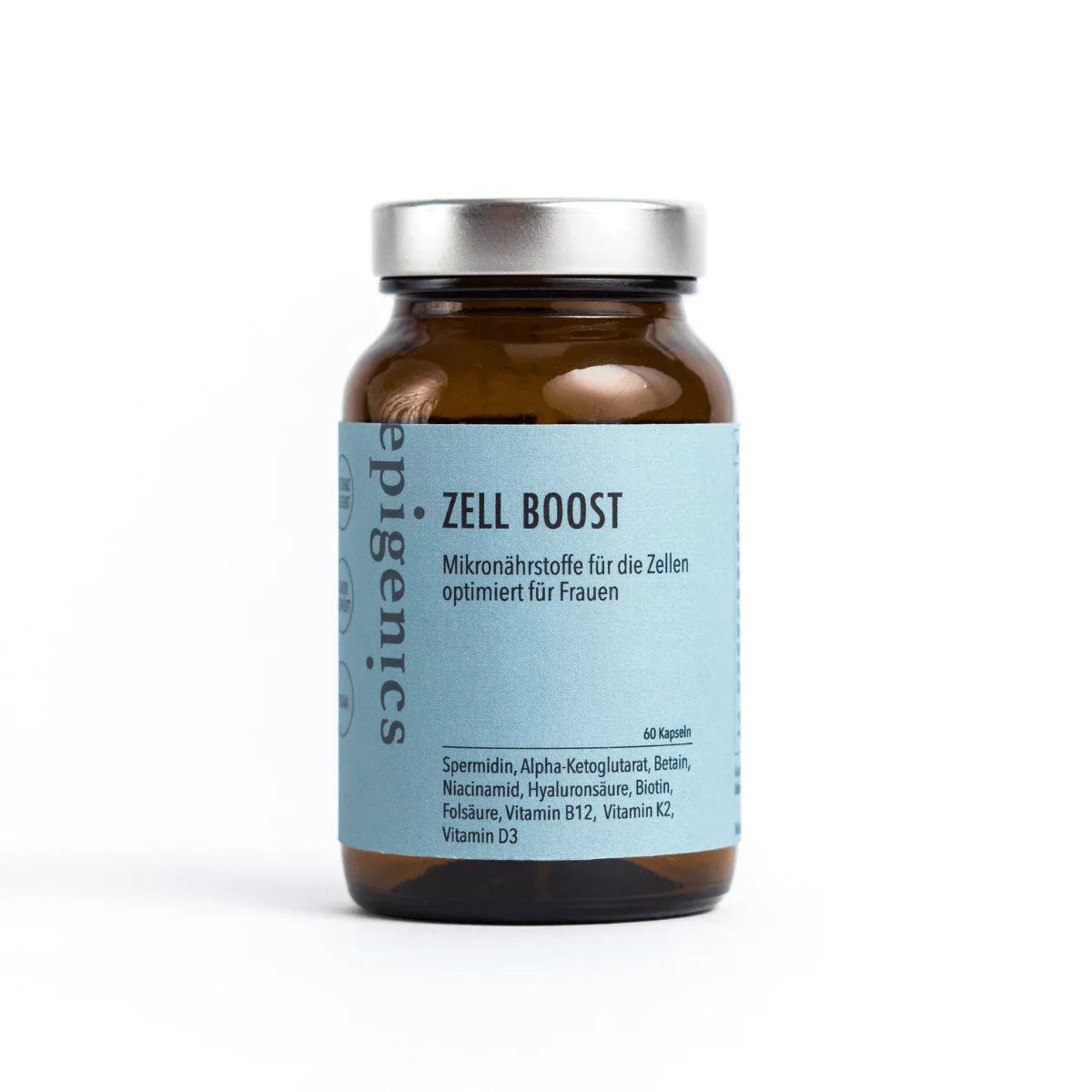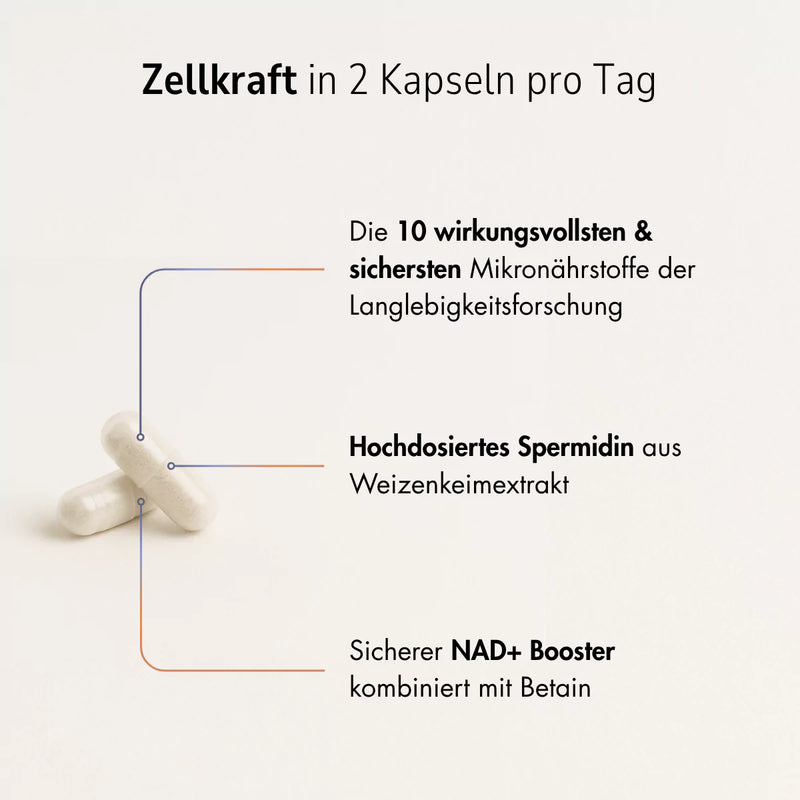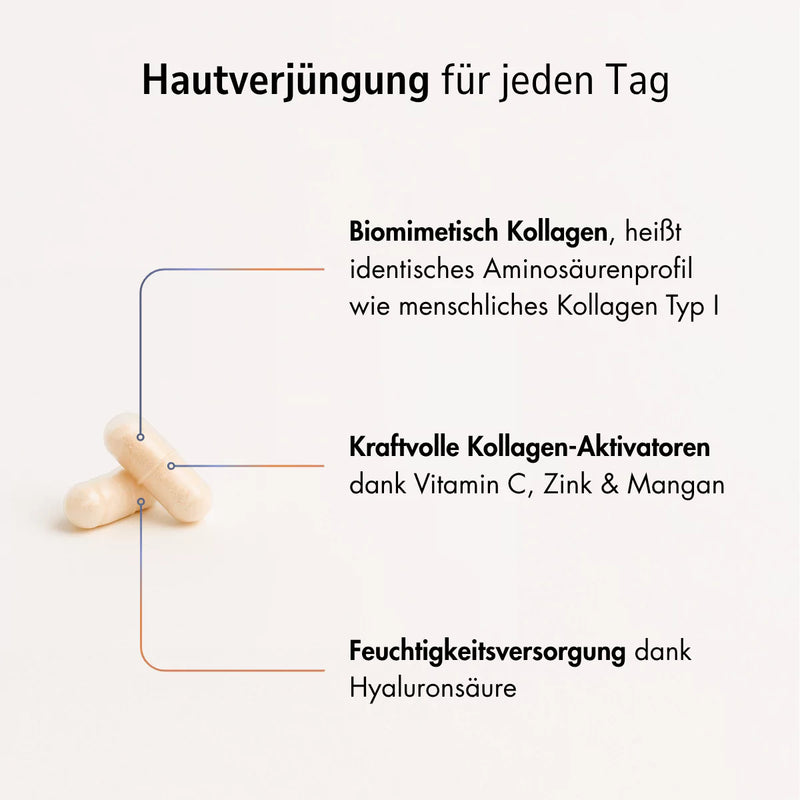Menopause-Penalty

Die verdeckten wirtschaftlichen Folgen der Wechseljahre für betroffene Frauen
Die Wechseljahre sind eine natürliche Lebensphase jeder Frau, die oft mit herausfordernden körperlichen und psychischen Symptomen einhergeht – von Hitzewallungen über Schlafstörungen bis zu Konzentrationsproblemen. Was dabei jedoch lange unterschätzt wurde: Die Wechseljahre können auch erhebliche berufliche und finanzielle Auswirkungen haben. Neue Untersuchungen sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Menopause-Penalty“, also einer Karrierenachteile durch die Wechseljahre. Eine aktuelle Stanford-Studie hat beispielsweise herausgefunden, dass Frauen, die aufgrund starker Menopausen-Beschwerden ärztliche Hilfe suchen, vier Jahre später durchschnittlich 10 % weniger verdienen (S).
Die „Menopause-Penalty“: Karriereknick in den Wechseljahren
Erst in jüngster Zeit beginnt die Forschung, die “Menopause-Penalty” – also die finanziellen Nachteile von Frauen in den Wechseljahren – systematisch zu untersuchen. Die erwähnte Stanford-Studie von 2025 liefert hierbei aufschlussreiche Zahlen. Untersucht wurden Gesundheits- und Beschäftigungsdaten aus Skandinavien (Norwegen und Schweden), um den Effekt einer Menopause-Diagnose auf die Erwerbstätigkeit und das Einkommen der Frauen zu messen. Das Ergebnis ist eindeutig: Frauen mit behandlungsbedürftigen Wechseljahrssymptomen erleiden im Schnitt einen deutlichen Einkommensrückgang. Vier Jahre nach der Diagnose bzw. nach dem Arztbesuch aufgrund von Menopausebeschwerden verdienen sie etwa 10 % weniger als zuvor (S). Hauptursache ist, dass viele dieser Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren oder den Job ganz aufgeben mussten, weil die Beschwerden mit dem bisherigen Arbeitspensum unvereinbar waren. Eine deutsche Erhebung von Onuava unter mehr als 1.000 betroffenen Frauen ergab, dass 74 % Konzentrationsprobleme hatten, 73 % erhöhten Stress empfanden und jede vierte Frau ihre Arbeitszeit reduzierte oder den Job wechselte (S).
Vergleich mit der Motherhood-Penalty
Die “Motherhod-Penalty” ist in vielen Ländern seit Jahren dokumentiert: Frauen mit Kindern verdienen im Durchschnitt weniger als kinderlose Frauen in vergleichbaren Positionen. Dieser Karriereknick durch Kinder entsteht etwa durch berufliche Auszeiten, Teilzeitarbeit und leider auch durch Vorurteile gegenüber Müttern im Job. Pro Kind ergibt sich nach Untersuchungen ein durchschnittlicher Lohnrückgang in den USA von etwa 3,6–3,8 %. Mit jedem weiteren Kind summiert sich diese Einbuße also drei Kinder bedeuten im Schnitt rund 10–11 % Gehalt weniger, verglichen mit Frauen ohne Kinder. Die Mutterschaftsstrafe spiegelt sich nicht nur in den Löhnen, sondern auch in geringeren Aufstiegschancen und einer Lücke bei Rentenansprüchen im Alter wider.
Vergleicht man nun Menopause-Penalty vs. Motherhood-Penalty, zeigen sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Beide Phänomene betreffen Frauen aufgrund biologischer Lebensereignisse – am Anfang der Familiengründung und am Ende der fruchtbaren Jahre – und führen zu Einkommensverlusten und Karriereeinbußen. Während jedoch die Mutterschaftsstrafe oft schrittweise mit jedem Kind zunimmt, kann die Menopause-Penalty relativ plötzlich zuschlagen. So entspricht der Befund von 10 % weniger Einkommen nach vier Jahren Wechseljahren in der Größenordnung schon dem Effekt von etwa drei Kindern auf das Gehalt einer Frau.
Ein entscheidender Unterschied ist allerdings, dass die Mutterschaftsstrafe mittlerweile gesellschaftlich bekannter ist – viele Unternehmen bieten z.B. Elternzeit, Wiedereinstiegsprogramme oder Kinderbetreuungszuschüsse, um Mütter (und Väter) zu unterstützen. Die Probleme von Frauen in den Wechseljahren blieben dagegen lange unsichtbar.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen
Die Folgen der Menopause-Penalty sind weitreichend – für die betroffenen Frauen, für Unternehmen und für die Gesellschaft insgesamt. Zunächst bedeutet es für viele Frauen einen erheblichen Verlust an Einkommen und finanzieller Sicherheit. Wer aufgrund von Kindern oder Wechseljahren weniger verdient, hat über die Lebenszeit hinweg weniger angespart, weniger Rentenansprüche und ein höheres Risiko, im Alter von Altersarmut betroffen zu sein. Die Gender-Pay-Gap wird durch diese lebensphasenbedingten Einschnitte weiter vergrößert, denn selbst bei gleicher Qualifikation häufen Frauen weniger Vermögen an. Auch der Gender-Pension-Gap (die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern) verschärft sich, da Frauen durch Babypausen und frühen Ausstieg in den Wechseljahren oft weniger Beitragsjahre und -beträge in die Rentenkasse einbringen.
Für Unternehmen gehen gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiterinnen verloren, wenn Frauen wegen fehlender Unterstützung in der Menopause kündigen oder in Teilzeit flüchten. Wissen, Erfahrung und Führungsstärke von Frauen über 50 sind wertvolle Ressourcen – ein vorzeitiges Ausscheiden dieser Frauen aus dem Arbeitsmarkt ist auch aus Unternehmenssicht ein Verlust. Zudem entstehen Kosten durch Fehlzeiten und verringerte Produktivität: In der Menopause kämpfen viele mit gesundheitlichen Beschwerden, was zu mehr Krankheitstagen führen kann. Studien zeigen, dass schwere Menopausen-Symptome die Wahrscheinlichkeit für Fehlzeiten und Leistungseinbußen deutlich erhöhen. In der Stanford-Untersuchung zeigte sich sogar ein Anstieg von Frühverrentungen bzw. Erwerbsminderungsrenten: Einige Frauen gingen wegen unerträglicher Wechseljahresbeschwerden dauerhaft aus dem Erwerbsleben und landeten in staatlichen Sozialprogrammen.
Gesamtgesellschaftlich bedeutet dies nicht nur höhere Sozialabgaben (etwa für Gesundheitskosten und Renten), sondern auch ein Verlust an Wirtschaftsleistung, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Wenn qualifizierte Frauen in ihren 50ern dem Arbeitsmarkt den Rücken kehren, entgehen der Wirtschaft wichtige Fachkräfte in einer Altersgruppe, die heute so aktiv ist wie nie zuvor.
Fazit: Doppelte Benachteiligung erkennen und entgegenwirken
Die sogenannte Menopause-Penalty ist ein reales und bislang unterschätztes Phänomen: Ähnlich wie die Motherhood-Penalty trägt sie dazu bei, dass Frauen im Berufsleben benachteiligt werden – mit messbaren Einkommensverlusten von bis zu 10 %, wie aktuelle Studien (z. B. von Stanford) zeigen.
Doch die Wechseljahre muss man nicht einfach hinnehmen. Es gibt wirksame Möglichkeiten, Beschwerden zu lindern – sowohl durch eine Hormonersatztherapie (HRT), die heute besser verstanden und sicherer ist als ihr Ruf, als auch durch natürliche Unterstützung mit einem gesunden Lebensstil und ausgewählten Supplements.
Auch Arbeitgeber sind gefragt: Ein offener Umgang mit dem Thema, flexible Arbeitszeiten, klimatisierte Ruheräume oder Schulungen für Führungskräfte können viel bewirken. Wenn wir die Menopause im Arbeitskontext ebenso ernst nehmen wie die Herausforderungen junger Eltern, profitieren nicht nur betroffene Frauen – sondern die gesamte Arbeitswelt.